Über 700 Jahre alt ist die Glasmachertradition im Bayerischen und Oberpfälzer Wald. Ein Blick in die Glashütten, Werkstätten und Museen entlang der Glasstraße
Einst war die Glasproduktion der wichtigste Industriezweig im Bayerischen Wald. Die Hauptrohstoffe Holz, Quarz und Pottasche waren im Übermaß vorhanden. Klöster und Kirchen brauchten schon im Mittelalter Fensterglas und waren die ersten Abnehmer. Aber auch Gläser, Butzenscheiben und Rosenkranzperlen entstanden in den Waldglashütten. Mit der Eisenbahn begann ab 1877 eine neue Ära. “Sie löste die Glasfuhrwerke, die teils wochenlang unterwegs waren und auf deren Fahrten vieles zu Bruch ging, als Transportmittel ab”, erzählt Sven Bauer, Sammlungspfleger im Glasmuseum Frauenau. “Das Glas aus dem Bayer- und Böhmerwald kam in die ganze Welt.” Bekannte Sport, Film- und Musikgrößen wie Formel1-Fahrer Sebastian Vettel, Komiker Hape Kerkeling und Musiker Andreas Gabalier haben heute einen Glaspokal aus Ostbayern im Regal stehen. Aber auch die rote Glaskugel des Fernsehsenders Vox wird hier produziert.
Der Ort Frauenau gilt als “gläsernes Herz” des Bayerischen Waldes. Drei Glashütten waren lange Zeit in der heute rund 3.000 Einwohner zählenden Gemeinde ansässig. 453 Jahre stellte die Familie Poschinger hier Glas her, seit Ende 2021 bleiben die Schmelzöfen kalt. Die Glashütte Gistl war bis in die 1970er Jahre der größte Arbeitgeber in der Gegend. Aus ihren Reihen stammt auch Valentin Eisch, Glasgraveur und Gründer der Glashütte Eisch. 1946 eröffnete er die dritte und damit jüngste Glashütte in Frauenau. Heute ist sie die einzig verbliebene im ehemaligen gläsernen Zentrum des Bayerwalds.
Vereinigung von Glas und Kunst
Michaela Eisch sitzt an ihrer Werkbank und lässt das Sektglas auf einem drehbaren Holzschemel vor sich kreisen. Flink fliegen ihre Finger über das Glas, mit einem Pinsel trägt sie gleichmäßig goldene Farbe auf. Die Bemalung und Gravur sind zwei der glasveredelnden Tätigkeiten, die Mitarbeiter noch heute in Handarbeit in der Glashütte Eisch ausführen. “Bis auf einen kleinen Studioglasofen, den wir für Führungen anheizen, laufen bei uns aber keine Öfen mehr”, erklärt Geschäftsführer Eberhard Eisch.

Gläserne Tischkultur der Glashütte Eisch
Heute ist die Glashütte Eisch weniger für ihr Kunsthandwerk, sondern mehr für ihre gläserne Tischkultur bekannt. Die mehrfach ausgezeichneten SensisPlus Gläser werden von Weinliebhabern weltweit geschätzt. “In diesen Gläsern erlebt der Wein eine ungeahnte Entwicklung der Aromen”, sagt Eberhard Eisch stolz. Dabei bleiben der ursprüngliche Charakter und die Struktur des Weins erhalten. Warum SensisPlus Gläser im Vergleich zu andern Weingläsern diese Eigenschaften hervorbringen und was dabei in der Herstellung zu beachten ist, möchte er nicht verraten.
Glasmacher: Arbeiten bei 70 Grad
Der Ofen erfüllt die Glashütte in Riedlhütte mit monotonem Summen. Warme Luft staut sich zwischen der Werkbank und dem Ofen. Johann Weishäupl wischt sich den Schweiß von der Stirn, während sein Chef Florian Köck eine Glasmacherpfeife – ein langes, schmales Metallrohr – an die Lippen führt und vorsichtig Luft in das Rohr entweichen lässt. Im Glastropfen am anderen Ende des Rohrs entsteht zunächst eine, dann noch eine weitere Kugel – der Rumpf einer Eule. Weishäupl, der Ältere der beiden, schnappt sich eine zweite Glasmacherpfeife aus dem Ofen und taucht das vordere Ende nacheinander in Behälter mit roten und violetten Glaskügelchen.
Die kleinste Glashütte Deutschlands
Zusammen mit einer Schulklasse sitzt auch der 72-jährige Erhard Köck in der Glashütte und beobachtet seinen Sohn und dessen Mitarbeiter bei der Arbeit. Er war es, der vor 28 Jahren in einer Garage in Riedlhütte die kleinste Glashütte Deutschlands gründete und den Grundstein für Glasscherben Köck legte. Das Glas, das in umliegenden Glashütten zu Bruch ging, diente ihm als Rohstoff. Heute ist die Glashütte die einzige im Grafenauer Raum, die noch täglich ihren Studioglasofen befeuert, um Besuchern die Kunst des Glasmachens näherzubringen.
Zum Video bei Glasscherben Köck geht es hier:
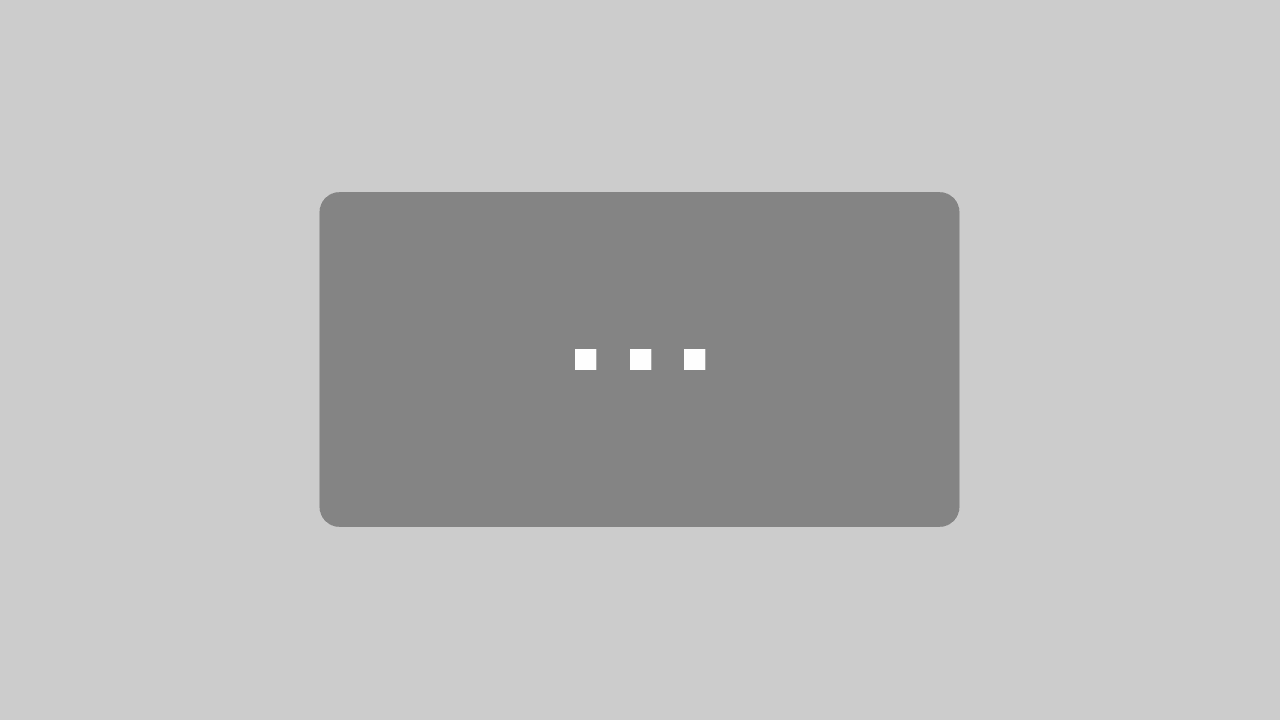
Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren
Wie Schnupftabak und Glas zusammenfanden
Was heute Garteninstallationen und Weingläser sind, waren früher die “gläsernen Bixl”. Gemeint sind Aufbewahrungsgefäße für Schnupftabak. Das Schnupfen von Tabak wurde ab dem späten 18. Jahrhundert im Bayerischen Wald immer beliebter. Natürlich mussten für diesen Zeitvertreib auch gläserne Aufbewahrungsgefäße her. “Seit den 1960er Jahren entwickelten sie sich aber immer mehr zu Sammlerstücken. Heute werden sie nur noch in wenigen Glashütten auf Anfrage gefertigt”, sagt Sven Bauer. Wer die “Bixl” in all ihren Farben und Formen sehen möchte, findet im Glasmuseum Frauenau eine kleine Ausstellung. Wer sich mehr für die Geschichte des Schnupftabaks interessiert, den schickt Sven Bauer weiter die Glasstraße entlang nach Grafenau zum weltweit einzigen Schnupftabakmuseum. Und wie zwischen Frauenau und Riedlhütte ist auch der Weg weiter nach Grafenau mit vielen Erlebnissen und Geschichten rund ums Glas gepflastert.
Diesen Beitrag teilen auf:












